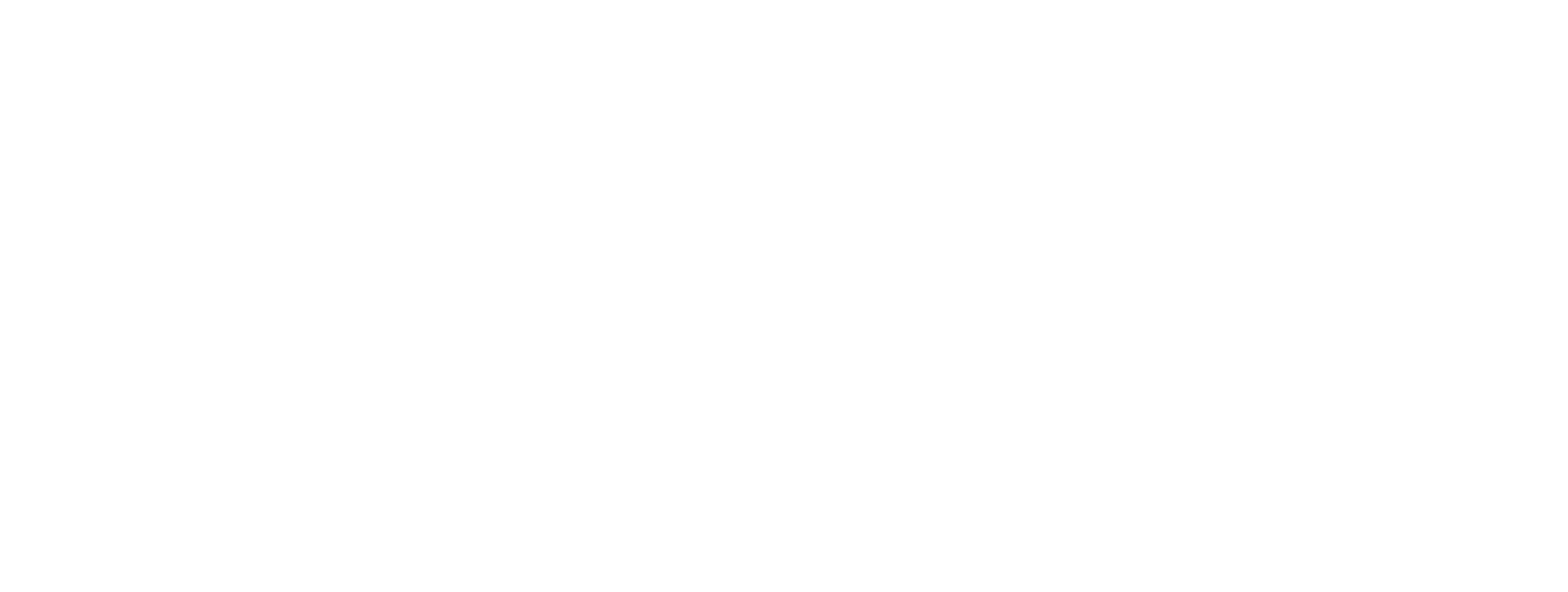"I bin a Tschickweib, aber i bring des Geld ham.“
– Die Arbeiterinnen der Tabakfabrik Stein (1850–1991)

In den ersten Jahrzehnten waren die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterinnen äußerst schwierig. Tabakarbeiterinnen seien unter allen Arbeiterinnen die am „schlechtestbezahlten und -behandelten“, schrieb die Gewerkschafterin Marie Kerndlinger, und weiter: „Von der ganzen Gesellschaft verachtet, führten sie ein wahres Sklavendasein“. Neben dem geringen Verdienst war die Fabriksarbeit auch durch lange Arbeitszeiten – bis zu 72 Stunden in der Woche – und unzureichende Gesundheitsversorgung gekennzeichnet. Beschimpfungen, körperliche Züchtigung und willkürliche Entlassungen durch Beamte, die zur Überwachung und Kontrolle eingesetzt waren, gehörten zum Alltag. Die noch lange für Tabakarbeiterinnen gebräuchliche Bezeichnung „Tschickweiber“ zeugt von ihrem geringen sozialen Status.
Die Tabakfabrik als soziales Unternehmen
1922 wurde die „neue Fabrik“, in der sich heute die Universität für Weiterbildung Krems befindet, eröffnet. Geplant wurde das Gebäude vom Wiener Architekten Paul Hoppe. Die Umsetzung sozialpolitischer Forderungen hatte inzwischen das Leben der Arbeiterschaft wesentlich verbessert. Darüber hinaus entwickelte sich die „Österreichische Tabakregie“ zu einem sozialen Musterunternehmen. Geboten wurden gute Entlohnung und Pensionen sowie zahlreiche betriebliche Sozialleistungen.
In der Steiner Tabakfabrik gab es 1931 über 1.000 Beschäftigte. Am Fabriksgelände standen eine Betriebsküche, eine Badeanstalt, ein Betriebsarzt und eine gut ausgestattete Krankenstation zur Verfügung. Im Betriebskindergarten wurden Kinder bereits ab zwei Monaten betreut, Schulkinder wurden im Hort versorgt. Rund um die Tabakfabrik wurden für die Belegschaft Wohnhäuser mit moderner Ausstattung errichtet.
Generationen von Frauen arbeiteten in der Tabakfabrik. 1991 wurde die Fabrik geschlossen. Ein Kapitel selbstbewusster weiblicher Präsenz in Stein und Krems ging damit zu Ende.
Ein Tag in der österreichischen Virginierfabrik Stein a. /d. Donau (Hans Brückner, Österreich, um 1928)